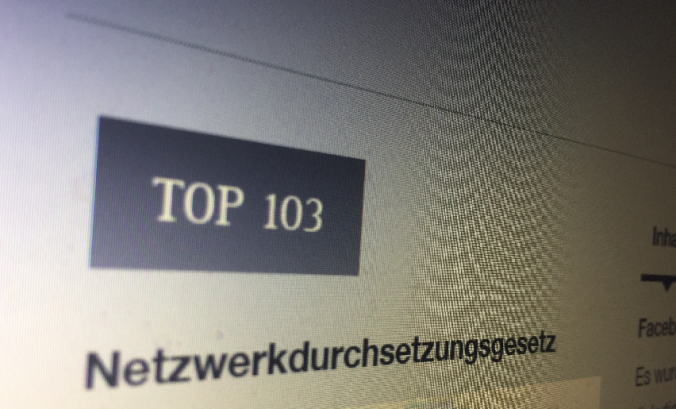Nachdem der Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 28. Juni 2017 noch erhebliche Änderungen an dem umstrittenen Entwurf für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) empfohlen hatte (BT-Drs. 18/13013), hat der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf mit diesen Änderungen am 30. Juni 2017 angenommen. Die abschließende Behandlung des Gesetzgebungsvorhabens im Bundesrat steht nun für Freitag, den 7. Juli 2017, an. Es wird gemeinhin erwartet, dass der Bundesrat dem NetzDG keine weiteren Steine in den Weg legen wird. Das umstrittene Gesetz wird damit voraussichtlich in Kraft treten, wenn der Bundespräsident nicht überraschenderweise seine Ausfertigung verweigern sollte. Nachdem die vorgesehenen Regelungen bereits zweimal Thema in diesem Blog waren, ist damit Zeit für eine kurze Zwischenbilanz aus rechtlicher und rechtspolitischer Sicht.
Hauptkritikpunkte berücksichtigt
Dabei ist zunächst festzuhalten, dasss die nun beschlossene Gesetzesfassung zentrale Kritikpunkte aufgenommen hat. Mit Blick auf den Schutz der Meinungsfreiheit aus Art. 5 des Grundgesetzes (GG) waren zuvor vor allem zwei Aspekte besonders problematisch: die vollständige Ausblendung desjenigen, dessen evtl. strafbare Äußerung gesperrt bzw. gelöscht werden soll, und – eng hiermit zusammenhängend – die starre Frist von sieben Tagen für die Löschung rechtswidriger (aber nicht offensichtlich rechtswidriger) Inhalte (siehe zum Ganzen den WWWelt-Beitrag vom 18. Juni 2017).
Das Fristproblem wurde im parlamentarischen Verfahren dadurch entschärft, dass die Sieben-Tages-Frist jetzt nur noch „in der Regel“ gilt. Diese Relativierung dient ausweislich der Begründung des Ausschusses dazu, „den sozialen Netzwerken in schwierigen Fallkonstellationen mehr Zeit zu geben für die Entscheidung, ob Inhalte strafrechtlich relevant“ sind. Zugleich wurde in diesem Zusammenhang auch auf eine Einbindung des Äußernden hingewirkt. Denn eine Überschreitung der Sieben-Tages-Frist soll nun auch möglich sein, „wenn die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts von der Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Umständen abhängt“. In diesen Fällen sieht die neu geschaffene Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 3 lit. a NetzDG-E vor, dass „das soziale Netzwerk … dem Nutzer vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben“ kann. Die Begründung zu dieser Regelung weist darauf hin, dass hiermit gerade auch der „Kontext einer Äußerung“ aufgeklärt werden soll.
In der Sache greift es ein wenig kurz, die Entscheidung über eine Einbindung des Äußernden nicht weiter vorzustrukturieren , etwa durch eine Soll-Bestimmung, von der nur in atypischen Situationen abgewichen werden kann. Dennoch sind diese Neuerungen im Interesse eines schonenderen Umgangs mit der Meinungsfreiheit doch ausdrücklich zu begrüßen. Damit rücken freilich andere Defizite des geplanten Regelwerkes in das Blickfeld.
Potentieller Konflikt mit den unionsrechtlichen Vorgaben zur Reaktionsfrist
So synchronisiert der verabschiedete Gesetzestext jetzt zwar die Frist für die Löschung (einfach) rechtswidriger Inhalte mit der entsprechenden Haftungsregel in § 10 S. 1 Nr. 2 des Telemediengesetzes (TMG) bzw. der ihm zugrundeliegenden Bestimmung in Art. 14 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr. Denn nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 NetzDG-E sind rechtswidrige Inhalte nunmehr „unverzüglich“ zu löschen. Das ist auch die Zeitspanne, innerhalb derer die telemedienrechtliche Haftungsprivilegierung greift. In § 3 Abs. 2 Nr. 3 NetzDG-E wird sie dann aber durch die Vorgabe „in der Regel innerhalb von 7 Tagen“ näher konkretisiert. Der Gesetzgeber geht also offensichtlich davon aus, dass eine „unverzügliche“ Löschung nur ausnahmsweise mehr Zeit in Anspruch nehmen darf. Während ihm diese Konkretisierung normalerweise sicherlich möglich ist, gilt das für die unionsrechtliche Vorgabe nicht ohne weiteres. Vielmehr sind Begriffe des Unionsrechts grundsätzlich in der gesamten EU autonom und einheitlich auszulegen (EuGH, NJW 2005, 1099, 1099 f. [Urt. v. 27.1.2005 – Rs. C-188/03]). Dass die Richtlinie 2000/31/EG, mit der die nationalen Vorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr unionsweit angeglichen werden sollen, in dieser Frage Raum für eine von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat abweichende Ausgestaltung lässt, erscheint zweifelhaft.
Dieses Problem hat möglicherweise auch der Rechtsausschuss erkannt. In der Begründung zu seinem Änderungsvorschlag führt er nämlich aus: „Unberührt bleibt ohnehin, dass die Privilegierung des § 10 des Telemediengesetzes (TMG) nur dann erhalten bleiben kann, wenn das soziale Netzwerk unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, tätig wird.“ Dem scheint die Vorstellung zugrunde zu liegen, dass die Regelungen des TMG, mit denen die Richtlinie 2000/31/EG umgesetzt werden, letzten Endes unabhängig von den Fristvorgaben des NetzDG sind. Das wäre freilich eine seltsame Konstruktion: Den Betreibern sozialer Netze würde ein Beschwerdemanagement vorgeschrieben, wobei sich das Gesetz derselben Begrifflichkeiten bedient wie die telemedienrechtliche Haftungsfreistellung, diese aber abweichend versteht. Der praktischen Wirksamkeit der Richtlinienumsetzung wäre hiermit kaum gedient.
Verschärft wird diese Diskrepanz durch eine weitere grundlegende Neuregelung, die am Regierungsentwurf vorgenommen wurde: Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 lit. b NetzDG-E gilt die Sieben-Tages-Frist nämlich auch dann nicht, wenn „das soziale Netzwerk die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach den Absätzen 6 bis 8 anerkannten Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung überträgt und sich deren Entscheidung unterwirft“. Diese Einrichtung muss dann eine „zügige Prüfung innerhalb von 7 Tagen“ sicherstellen (§ 3 Abs. 6 Nr. 2 NetzDG-E). Macht der Betreiber von dieser Möglichkeit Gebrauch, ist sein Beschwerdemanagement also selbst dann gesetzeskonform, wenn in Fällen, in denen die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von wenigen Tagen getroffen werden könnte, die betreffenden Beschwerden innerhalb von sieben Tagen an die anerkannte Einrichtung weitergeleitet werden – und dort dann erst nach weiterer Bearbeitungszeit erledigt werden.
Unzureichende Regelung für offensichtlich rechtswidrige Inhalte
Ebenfalls problematisch bleibt die Regelung für offensichtlich rechtswidrige Inhalte. Hieran sind im parlamentarischen Verfahren keine Änderungen vorgenommen worden. Es bleibt also dabei, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte „innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde“ gelöscht bzw. gesperrt werden müssen. Insoweit betont der Bericht des Rechtsausschusses, dass Inhalte nur dann offensichtlich rechtswidrig sind, „wenn die Rechtswidrigkeit ohne vertiefte Prüfung, d. h. von geschultem Personal in der Regel sofort, mit zumutbarem Aufwand aber in jedem Fall binnen 24 Stunden erkannt werden kann“. Bei dann noch verbleibenden Zweifeln liege keine offensichtliche Rechtsverletzung vor. Diese Klarstellung ist zu begrüßen: Inhalte können nur dann als „offensichtlich“ rechtswidrig eingestuft werden, wenn ihnen die Rechtswidrigkeit gewissermaßen „auf die Stirn geschrieben“ steht. Angesichts der weitreichenden Bedeutung der Meinungsfreiheit für die Bewertung einer Äußerung (siehe auch dazu den WWWelt-Beitrag vom 18. Juni 2017) wird man nur in ganz seltenen Ausnahmefällen von einer solchen Evidenz ausgehen können.
Allerdings erweist sich die Abkopplung von der Haftungsprivilegierung in § 10 S. 1 Nr. 2 TMG auch an dieser Stelle als wenig gelungen: Bei strafbaren Inhalten, an deren Strafbarkeit ausnahmsweise keine vernünftigen Zweifel bestehen, kann eine Löschfrist von 24 Stunden sogar viel zu lang sein, wäre also eine schnellere Reaktion geboten. Zu denken ist hier bespielsweise an konkrete Mordaufrufe unter Nennung der Privatanschrift des Opfers (Bedrohung nach § 241 StGB) oder an die Verbreitung von offensichtlich heimlich im heimischen Umfeld angefertigten Nacktphotos (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen nach § 201a StGB). In solchen Fällen wird der Schutz der betroffenen Rechtsgüter unter Umständen ein wesentlich schnelleres Handeln erfordern: Nichts ist in sozialen Netzen älter als ein Post oder Tweet vom Vortag. Das ist in der Aussprache im Bundestag auch ausdrücklich erkannt worden, ohne dass hieraus jedoch irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden.
„Wenn erst einmal etwas in die digitale Welt entsendet und um die Welt gejagt worden ist, dann ist das nicht mehr rückholbar.“
Alexander Hoffmann (CDU/CSU), BT-Plenarprotokoll 18/244, 25126 D
Die pauschale Vorgabe einer Reaktionszeit von 24 Stunden erweist sich daher gerade bei einer Beschränkung auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte hier als unzureichend. Das ist umso unverständlicher, als man auch in diesem Zusammenhang ohne weiteres eine „unverzügliche“ Löschung hätte einfordern und diese dann auf „(in der Regel) jedenfalls aber binnen 24 Stunden“ begrenzen können. Die in der parlamentarischen Debatte als Argument für die Sinnhaftigkeit des NetzDG bemühte „Schülerin, die in der Umkleidekabine fotografiert wird und deren Bild in die Netzwerke gestellt wird“ (vgl. BT-Plenarprotokoll 18/244, 25124 D), schützt das Gesetz somit bestenfalls unzureichend.
Keine strafrechtliche Verfolgung der strafbaren Inhalte
Das vom NetzDG eingeforderte Beschwerdemanagement ist aber nicht nur in seiner zeitlichen Ausgestaltung (in mehrerlei, z. T. gegenläufiger Hinsicht) defizitär. Es ist auch kein hinreichend nachhaltiges Instrument zur Bekämpfung strafbarer Inhalte. Das liegt daran, dass es unmittelbar nur auf eine Löschung bzw. Sperrung von strafbaren bzw. für strafbar gehaltenen Inhalten zielt. Digitale Inhalte sind aber beliebig reproduzierbar. Das gilt nicht nur für ihren Urheber, der sie an anderer Stelle oder aber sogar im selben sozialen Netz nach einer Sperrung oder Löschung ohne weiteres erneut veröffentlichen kann, gegebenenfalls nach Vornahme kleinerer Modifikationen. Es gilt vielmehr auch für andere Nutzer, die etwa als Teil einer bestimmten „Gesinnungsblase“ die fremden Inhalte gerade nach einer Sperrung oder Löschung im eigenen Namen weiterverbreiten können.
Insoweit ist von Bedeutung, dass das NetzDG ausdrücklich nur auf strafbare Inhalte, insbesondere im Bereich der so bezeichneten „Hasskriminalität“, zielt. Hier fordert der Gesetzgeber von den Betreibern sozialer Netze also ausdrücklich, dass sie umfassende organisatorische Vorkehrungen zur Beseitigung dieser Inhalte treffen. Andere rechtswidrige Inhalte, die im Falle der Kenntnis unter Umständen nach allgemeinen Grundsätzen auch zu löschen wären, werden von dieser gesetzlichen Vorgabe nicht erfasst. Bei einer solchen Fokussierung auf strafbare Inhalte wäre es aber nur konsequent, wenn es der Staat nicht bei einer bloße Unsichtbarmachung der betreffenden Äußerungen beließe, sondern seinen Strafanspruch auch ernst und die vermeintlichen Straftaten zum Anlass entsprechender Strafverfahren nähme. (In diesen könnten sich dann natürlich auch die rechtsstaatlichen Schutzgarantien zugunsten der vermeintlichen Straftäter entfalten.)
Es wirkt widersprüchlich, einerseits von den Betreibern sozialer Netze ein Vorgehen gegen spezifisch strafbare Inhalte zu verlangen, hierbei aber andererseits der eigentlich gesetzlich vorgesehenen Reaktion auf Straftaten – nämlich der Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen – keinerlei Aufmerksamkeit zu widmen. Das gilt insbesondere für den Bereich der sog. Offizialdelikte, d. h. solcher Straftaten, die von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu verfolgen sind. Hierzu gehört u. a. die Volksverhetzung nach § 130 StGB, also das „klassische“ Delikte der Hasskriminalität.
Der Regelungssystematik des NetzDG hätte es deshalb entsprochen, für das Beschwerdemanagement der Betreiber sozialer Netze auch eine Verpflichtung vorzusehen, die zuständigen Staatsanwaltschaften über erfolgte Sperrungen bzw. Löschungen zu informieren. Hierdurch würde die Wirksamkeit des intendierten Schutzes vor „Hasskriminalität“ und anderen Straftaten erheblich erhöht. Zugleich wäre auf diese Weise ein Korrektiv geschaffen worden, das zumindest tatsächlich und mittelbar der Gefahr zu weitflächiger Sperrungen bzw. Löschungen entgegenwirken könnte. (Sollte sich nach Durchführung entsprechender Ermittlungsverfahren nämlich herausstellen, dass oftmals keine Straftaten vorliegen, dürfte sich die Praxis des betreffenden Beschwerdemanagements hieran anpassen.)
Eine solche mehr oder weniger automatische Ausleitung von Sperrungs- bzw. Löschungsentscheidungen an die Staatsanwaltschaften würde zweifelsohne zu einem erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwand bei der Justiz führen. Diesen Mehraufwand müsste der Staat aber hinnehmen, insbesondere da er ja den privaten Betreibern sozialer Netze einen entsprechenden (bzw. wegen ihrer Funktion als Vorfilter evtl. sogar noch höheren) Aufwand im Allgemeininteresse aufbürdet. Zugleich könnte der Staat so dokumentieren, dass es ihm tatsächlich um eine Bekämpfung von Straftaten in sozialen Netzen und nicht lediglich um die Einschränkung ihrer Sichtbarkeit geht, getreu dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“. In diesem Sinne hat auch Bundesjustizminister Heiko Maas selbst in der parlamentarischen Aussprache gefordert, dass Beleidigungen im Netz oder Mordaufrufe nicht „ohne Konsequenzen“ bleiben dürften (siehe BT-Plenarprotokoll 18/244, 25116 C). Sein Gesetzentwurf wird diesen markigen Worten nicht gerecht.
Missachtung des Antragserfordernisses bei absoluten Antragsdelikten
Erweist sich das nun beschlossene NetzDG somit als inkonsequent, soweit es um die Reaktion insbesondere auf Offizialdelikte wie die Volksverhetzung geht, greift es in anderer Hinsicht über das Strafrecht hinaus, indem es die Sperrung bzw. Löschung auch faktisch straffreier Inhalte verlangt. Das betrifft die sog. absoluten Antragsdelikte, also Straftaten, die ausschließlich auf Antrag (in der Regel) des Verletzten strafrechtlich verfolgt werden. Hierzu zählt im Anwendungsbereich des NetzDG insbesondere die Beleidigung nach § 185 StGB, wie sich aus § 194 StGB ergibt. In solchen Fällen würde jedenfalls dann auch ein polizei- bzw. ordnungsrechtliches Vorgehen unterbleiben, wenn erkennbar ist, dass der Beleidigte von der Äußerung Kenntnis hat, sie aber hinnimmt. Denkbar ist so etwas ohne weiteres gerade in öffentlichen Diskussionen, etwa wenn sich ein der Diskussionsteilnehmer durch seine beleidigenden Äußerungen „demaskiert“ hat. Allein der Wunsch Dritter, dass solche Beleidigungen entfernt werden sollten, reicht in einer derartigen Situation nicht aus, so dass es insbesondere auch keiner Haftungsprivilegierung bedarf. Die objektiv strafbare Äußerung kann in diesen Fällen vielmehr in der Welt bleiben und führt insbesondere auch nicht zu Maßnahmen der Strafverfolgung.
Das NetzDG nimmt hierauf jedoch keine Rücksicht. Es will vielmehr ausweislich der Gesetzesmaterialien ausdrücklich „objektiv strafbare Inhalte“ erfassen. Zugleich begrenzt das vom Bundestag beschlossene Gesetz den Kreis der Beschwerdeberechtigten nicht auf von der Straftat Verletzte, sondern sieht ein Tätigwerden aufgrund von Beschwerden beliebiger Nutzer vor. Das ist zwar insoweit folgerichtig, als es bei einigen der erfassten Delikte keine individuellen Verletzten gibt, die sich über entsprechende Äußerungen beschweren könnten. Bei den absoluten Antragsdelikten führt diese Konstruktion indes dazu, dass gegebenenfalls solche Äußerungen gesperrt oder gelöscht werden, ohne dass der Verletzte selbst das überhaupt wünscht. Diese Folge der gesetzlichen Konstruktion hat zur Folge, dass den betreffenden Meinungen Grenzen gesetzt werden, die das Strafrecht selbst überhaupt nicht vorsieht. Ob ein solches Überspielen der Antragsgebundenheit mit Blick auf die Konsequenzen für die Meinungsäußerung noch verfassungsrechtlich zulässig ist, erscheint zweifelhaft. Jedenfalls ist das NetzDG aber auch insoweit schlecht in den allgemeinen rechtlichen Rahmen eingebunden, dessen Durchsetzung es eigentlich dienen soll.
Keine Regelung eines Wiedereinstellungsanspruchs
Die finale Fassung des NetzDG bleibt aber auch noch hinsichtlich eines weiteren Aspekts verfassungsrechtlich fragwürdig. Sie sieht nämlich nach wie vor nicht vor, dass die Betreiber sozialer Netze zu Unrecht gesperrte oder gelöschte Inhalte wieder zugänglich machen müssen. Lediglich in den Fällen, in denen sich der Betreiber der Entscheidung einer anerkannten Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung unterwirft, ist ein solcher Wiedereinstellungsanspruch angedeutet. Nach § 3 Abs. 6 Nr. 4 NetzDG muss bei einer solchen Einrichtung „eine Beschwerdestelle eingerichtet“ werden. Durch diese doch eher knappe Vorgabe werde laut der Begründung des Rechtsausschusses „sichergestellt, dass es in Fällen der unberechtigten Sperrung tatsächlich zulässiger Inhalte schnell und unkompliziert zur Wiederherstellung der Inhalte kommt“.
Betreiber sozialer Netze sind aber nicht verpflichtet, solche Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung einzubinden. Verzichten sie hierauf, fehlt es an einer entsprechenden Vorgabe im NetzDG. Das ist systemwidrig: Wenn zum Schutz der Meinungsfreiheit ein solcher Mechanismus bei der Einbindung von Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung geschaffen wird, darf er im eigentlich vorgesehenen internen Beschwerdemanagement nicht fehlen. Das sehen offensichtlich auch die Regierungsparteien mittlerweile ähnlich: So hat mit Dr. Johannes Fechner von der SPD einer der drei Berichterstatter des Rechtsausschusses in der parlamentarischen Debatte (BT-Plenarprotokoll 18/244, 25126 B) und auch in einem Interview mit der taz bereits angekündigt, das Gesetz um eine entsprechende Regelung zu ergänzen. Der Grund, warum man hiervon im parlamentarischen Verfahren abgesehen hat, nämlich eine erneute Notifizierung bei der Kommission zu vermeiden, ist dabei freilich kaum geeignet, um den Verzicht auf eine grundrechtsschonendere Ausgestaltung des Gesetzes zu rechtfertigen.
Fazit
Auch nach den Änderungen im parlamentarischen Verfahren ist das NetzDG somit nicht nur schlecht abgestimmt mit den telemedienrechtlichen Haftungsprivilegien. Obwohl einige zentrale Kritikpunkte adressiert wurden, bleibt es vielmehr auch weiterhin verfassungsrechtlich heikel. Auf der einen Seite ist es nur begrenzt wirksam, um gegen „Hasskriminalität“ und andere Straftaten in sozialen Netzen vorzugehen, da es (1.) gerade bei besonders offensichtlichen und schwerwiegenden Rechtsverletzungen zu langsame Reaktionen hinnimmt sowie (2.) es bei der Ausblendung des konkreten Inhalts belässt und von einer jedenfalls bei Offizialdelikten eigentlich naheliegenden Einschaltung der Strafverfolgungsorgane absieht. Auf der anderen Seite nimmt das NetzDG weiterhin nur am Rande Rücksicht auf die besonderen Anforderungen der Meinungsfreiheit, indem es (1.) eine Sperrung bzw. Löschung im Falle absoluter Antragsdelikte unabhängig von einem entsprechenden Begehren des Verletzten selbst hinnimmt und (2.) einen Mechanismus für die Wiedereinstellung zu Unrecht gesperrter bzw. gelöschter Inhalte ohne sachlichen Grund nur bei der Einbindung einer Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung vorsieht (bzw. andeutet). Das Gesetz bleibt damit ein misslungener Versuch, auf die Herausforderungen der Kommunikation in sozialen Netzen zu reagieren.
Andreas Blohm
Neueste Artikel von Andreas Blohm (alle ansehen)
- Mastodon-Städtereisetipps Stuttgart - 28. August 2023
- Kita-Warnstreiks – Schreiben an die kommunalen Arbeitgeber - 7. März 2022
- Geschwister in Bands – eine Übersicht - 4. Februar 2022