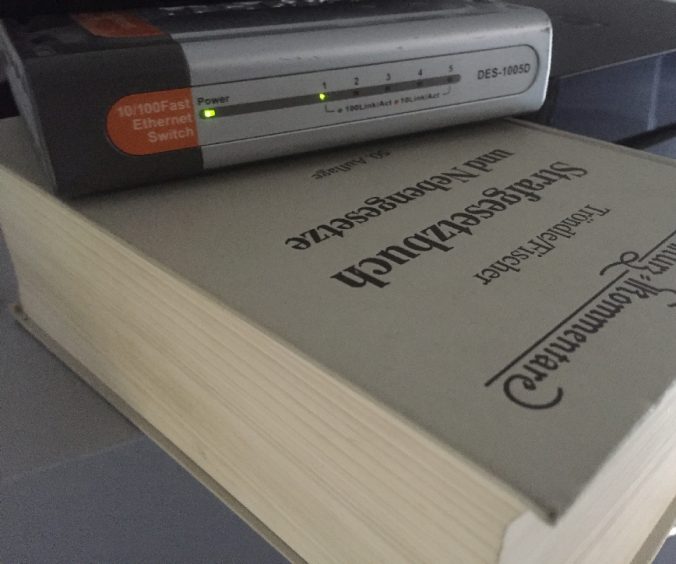Die Bundesregierung hat unlängst den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) vorgelegt (BR-Drs. 315/17). Das Gesetzesvorhaben reagiert auf eine vermeintlich „massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und insbesondere in den sozialen Netzwerken“ und richtet sich gegen „Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden können“. Dem soll das neue Gesetz zusammen mit einer im selben Zuge geplanten Ergänzung des Telemediengesetzes (TMG) insgesamt vier Instrumente entgegensetzen: (1.) eine Berichtspflicht der „Anbieter“ sozialer Netzwerke über ihren Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen, (2.) die Verpflichtung zur Einrichtung eines Verfahrens über den Umgang mit solchen Beschwerden, (3.) die Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten und (4.) einen Auskunftsanspruch der in ihren Persönlichkeitsrechten betroffenen Opfer entsprechender Straftaten gegen die Diensteanbieter. Dieses Maßnahmenpaket mag auf den ersten Blick weitgehend harmlos erscheinen. Der Eindruck trügt jedoch. U. a. soll das Beschwerdeverfahren gewährleisten müssen, dass der „Anbieter“ des sozialen Netzwerks offensichtlich rechtswidrige – konkret: gegen bestimmte, im Einzelnen vorgegebene Strafvorschriften verstoßende – Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde sperrt oder entfernt und auch jenseits der Offensichtlichkeitsschwelle jeden in diesem Sinne rechtswidrigen Inhalt innerhalb von sieben Tagen sperrt oder entfernt. Die gesetzlichen Verpflichtungen sind überdies z. T. unter im Einzelnen nicht ganz klaren Voraussetzungen mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro bewehrt. Gerade auch in den sozialen Netzen hat sich daher ein Sturm der Entrüstung gegen den Entwurf des NetzDG entfacht. Das ist angesichts der für Meinungsblasen typischen Empörungstendenz an sich nicht verwunderlich. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Gesetzesvorhaben auch im rechtswissenschaftlichen Schrifttum mit singulären Ausnahmen fast ausschließlich auf Kritik gestoßen ist.
Fast ausnahmslose Ablehnung des Gesetzesvorhabens
So verstößt der Gesetzentwurf aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI) gleich in mehrfacher Hinsicht gegen EU- und Verfassungsrecht. Prof. Dr. Dirk Heckmann und Jörg Wimmers machen für die DRGI in der Zeitschrift „Computer und Recht“ (CR 2017, 310) eine Vielzahl von Verstößen gegen die Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr aus. In verfassungsrechtlicher Hinsicht halten sie das Vorhaben für unvereinbar mit dem Anspruch des sich Äußernden auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG), da dieser durch die einseitige Verlagerung der Rechtsdurchsetzung auf die Diensteanbieter keine wirksame Möglichkeit habe, auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen. Weiter rügen sie einschnürende Effekte für die Kommunikationsgrundrechte, insbesondere mit Blick auf das spürbare „Risiko für die Entfernung zulässiger Inhalte“, auf die Schaffung eines Anreizes, „im Zweifel eine Löschung vorzunehmen“, und auf die Erwartung, dass es zu einem „Dammbruch durch Meldungen von vermeintlich Betroffenen“ kommen wird, „die sich die kurzen Fristen und erheblichen finanziellen Risiken der Betreiber sozialer Netzwerke zu Nutze machen wollen“. Darüber hinaus kritisieren sie auch die Ausweitung des Auskunftsanspruchs als unausgereift und die ebenfalls als Bestandteil des Beschwerdeverfahrens vorgesehene Pflicht zur Speicherung der betreffenden Inhalte zu Beweiszwecken auf inländischen Servern.
Auch Thorsten Feldmann macht in der Zeitschrift „Kommunikation & Recht“ (K&R 2017, 292) „erheblich[e] verfassungs- und europarechtlich[e] Bedenken“ geltend. Er bezweifelt schon die Gesetzgebungskompetenz des Bundes, gerade auch mit Blick auf den Umstand, dass gegen zahlreiche der nun hervorgehobenen Straftaten bereits auf Grundlage des Jugendmedienschutzstaatsvertrages (JMStV) gegen die Anbieter vorgegangen werden könne, es also bereits länderrechtliche Parallelregelungen gebe. In verfassungsrechtlicher Hinsicht weist er ebenfalls schwerpunktmäßig auf drohende Einschüchterungseffekte hin, die in letzter Konsequenz zu einer „Schere im Kopf“ führen würden und durch eine Vielzahl von Unklarheiten im Gesetzentwurf noch befördert würden, vor deren Hintergrund mit der Löschung auch rechtmäßiger Äußerungen zu rechnen sei. Darüber hinaus geht er ebenfalls von einer Kollision „mit zentralen Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie“ aus. Abschließend kommt er zu dem Fazit, dass der Gesetzentwurf „an vielen Stellen“ krankt und „verworfen“ gehört.
In einem Gutachten für den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) befasst sich Prof. Dr. Gerald Spindler allein mit der Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs mit EU-Recht. Diese verneint er in mehrfacher Hinsicht. Zunächst konstatiert er ebenfalls zahlreiche Verstöße gegen die Richtlinie 2000/31/EG. Daneben sieht er aber auch Verstöße gegen des europäische Datenschutzrecht, insbesondere da hier verfahrensrechtliche Schutzvorkehrungen und Vorgaben zur gerichtlichen Kontrolle fehlen.
Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Ladeur und Prof. Dr. Tobias Gostomzyk beleuchten in der Zusammenfassung eines weiteren Gutachtens für den BITKOM die verfassungsrechtlichen Implikationen des Gesetzesvorhabens. Im Ergebnis haben auch sie „erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, die den Regierungsentwurf insgesamt als nicht haltbar erscheinen lassen“. Das betrifft die Gesetzgebungszuständigkeit und die Verwaltungskompetenz des Bundes, den Anspruch des Äußernden auf rechtliches Gehör, der sich zwar nicht aus Art. 103 Abs. 1 GG, aber in vergleichbarer Weise aus der Verfahrensdimension des Grundrechts der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG ergebe, verschiedene Bestimmtheitsmängel und die unklare Abgrenzung von Verwaltungs- und Bußgeldverfahren. Vor allem aber sehen sie auch materielle Verfassungsverstöße, einerseits mit Blick auf die Berufsausübungsfreiheit der Diensteanbieter, andererseits aber auch gegen die Meinungsfreiheit, namentlich da die kurzen Fristen keine angemessene Grundrechtsprüfung und die vorgesehenen Verfahren keinen schonenden Interessensausgleich erlaubten, und gegen weitere Kommunikationsgrundrechte, etwa die Informationszugangsfreiheit anderer Nutzer.
Einer umfassenden rechtlichen Analyse haben den Gesetzentwurf auch Dr. Britta Heymann und Dr. Malek Barudi unterzogen. Auch sie bezweifeln die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes und die Vereinbarkeit mit der Richtlinie 2000/31/EG. Darüber hinaus sehen sie ebenfalls „starke Anreize, Löschungen ohne Prüfung vorzunehmen, da soziale Netzwerke bestrebt sein werden, Risiken zu vermeiden“, so dass das „Risiko für die Entfernung zulässiger Inhalte … offenkundig“ sei und der „Gesetzesentwurf … einschnürende Effekte auf die Meinungs- und Informationsfreiheit haben“ werde. Weiter rügen auch sie die unzureichende Einbindung der Äußernden selbst und die nur sehr beschränkte gerichtliche Kontrolle der vorgenommenen Sperrungen, während der Gesetzentwurf eine Einbindung der Gerichte nur dann vorsehe, „wenn ein Inhalt nicht gesperrt wurde“. Der vorgesehene Auskunftsanspruch beruhe schließlich nicht auf einer Abwägung der hiervon betroffenen Interessen.
Ebenfalls kritisch bewertet wird das Gesetzesvorhaben von Prof. Dr. Marc Liesching in einem Beitrag für das beck-blog. Einleitend zeigt er mehrere konzeptionelle Unstimmigkeiten des Entwurfs auf, indem er u. a. darauf hinweist, dass der Entwurf in Wirklichkeit gerade keine bestehende Löschungspflicht aufgreife, sondern eine solche erst schaffe, und stellt außerdem kritische Fragen, etwa danach, ob das als unzureichend angemahnte Sperrverhalten der Anbieter zu entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden geführt hat. In seiner verfassungsrechtlichen Bewertung geht auch dieser Autor ohne weiteres von einem Eingriff in die Meinungsfreiheit aus, da „faktisch ein System der ‚Löschung im Zweifelsfall‘ zwangsläufig etabliert“ werde. Weiter sieht er aber auch einen Eingriff in die Informationsfreiheit der Nutzer und überdies in die Presse- und Rundfunkfreiheit, da insbesondere durch die Ausnahme für Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verantwortet werden, journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote Dritter uneingeschränkt den gesetzlichen Vorgaben unterlägen. Zwar seien alle diese Grundrechte nicht schrankenlos gewährt. Den hierfür relevanten verfassungsrechtlichen Vorgaben genüge das Gesetz aber nicht. Es verfolge schon keinen legitimen Zweck, da die Vermeidung von Straftaten bereits Aufgabe der Strafjustiz sei, während die Absicht, „Äußerungen mit schädlichem oder in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlichem Inhalt zu behindern, … nach der Rechtsprechung des BVerfG gerade illegitim“ sei. Überdies kämen die Auswirkungen der vorgesehenen Sperrverpflichtungen materiell u. U. einem zensurgleichen Eingriff nahe. Des Weiteren liege eine sachlich nicht gerechtfertigte und damit diskriminierende Ungleichbehandlung zwischen Betreibern von sozialen Netzen mit mehr und weniger als zwei Millionen Nutzern vor. Zu guter Letzt zwinge die vorgesehene Verpflichtung zur (vorübergehenden) Speicherung gesperrter Inhalte die Diensteanbieter dazu, ggf. auch kinderpornographische Inhalte zu speichern, obwohl bereits deren Besitz strafbar ist.
In einem weiteren, etwas kürzeren Beitrag für das beck-blog kommt auch Prof. Dr. Thomas Hoeren zu dem Schluss, dass das vorgesehene Gesetz gegen vorrangiges Recht verstieße. Er betrachtet dabei allein das EU-Recht vertieft, und hier namentlich die Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr. Wie auch die anderen Rechtswissenschaftler, die sich mit den Vorgaben der „E-Commerce“-Richtlinie (ECRL) befasst haben, sieht er insbesondere das Verhältnis zum Herkunftslandprinzip der Richtlinie kritisch, aber auch die Verpflichtung anderer in der EU ansässsiger Anbieter, Daten in Deutschland zu speichern und einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Insgesamt kommt er zu dem Ergebnis, dass der Gesetzentwurf „in der derzeitigen Fassung der Zielsetzung der ECRL, eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu verhindern …, diametral entgegen[läuft]“.
Nachbesserungsbedarf selbst aus Sicht der wenigen Befürworter
Während somit eine beachtliche Phalanx von Juristen den Gesetzentwurf für (beinahe schon offensichtlich) rechtswidrig hält, findet er nur singulär grundsätzliche Zustimmung. So hält Dominik Höch in der Zeitschrift „Kommunikation & Recht“ (K&R 2017, 289) den Gesetzentwurf für „richtig, notwendig und im Wesentlichen auch durchführbar“. Doch selbst er erachtet Nachbesserungen für erforderlich. Insbesondere solle nicht der einzelne Verstoß gegen Prüfungs- und Löschpflichten bußgeldbewehrt sein. Darüber hinaus beruht seine grundsätzlich positive Bewertung auf der Annahme, die sozialen Netzwerke würden für die Meinungsfreiheit kämpfen und eben nicht den leichteren und haftungsvermeidenden Weg der Löschung von Beiträgen gehen. Diese Annahme steht im Widerspruch nicht nur zu der Einschätzung praktisch aller kritischen Autoren. Sie steht auch im Widerspruch zu einer bereits jetzt zunehmenden Zahl von nicht immer einleuchtenden Sperrungen beim sozialen Netzwerk Twitter. Und ihr widerspricht auch Prof. Dr. Martin Eifert, der in der Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ (NJW 2017, 1450) ebenfalls „entgegen der breit angelegten Kritik für eine stärkere Regulierung“ argumentiert. Denn auch er hält es für „naheliegend“, dass die Unternehmen im Zweifelsfall Beiträge eher sperren würden. Trotz seiner grundsätzlichen Zustimmung für eine stärkere Inanspruchnahme der „Intermediäre im Internet“ fordert er daher die Schaffung zusätzlicher Transparenzpflichten. Es müsse eine Veröffentlichung ihrer „Entscheidungen … mit einer Begründung“ vorgesehen werden, um „sachwidrigen Anreizstrukturen bei den Intermediären entgegenzuwirken“.
Selbst die wenigen Autoren, die dem Gesetzesvorhaben grundsätzlich positiv gegenüberstehen, halten somit Nachbesserungen in ganz zentralen Punkten für erforderlich. Ganz überwiegend erachtet die juristische Fachwelt den Gesetzentwurf aber sogar noch weitergehend für in mehrerlei Hinsicht unionsrechts- und verfassungswidrig. Die hierfür vorgebrachten Argumente sind in ihrem Kern beachtlich bzw. kaum ernsthaft zu bezweifeln. Letztlich stellt sich die Frage, warum die Entscheidung, ob Inhalte rechtswidrig im Sinne vorgegebener Straftatbestände sind, aufgrund privater Beschwerden innerhalb sehr kurzer Fristen und ohne angemessene Einbindung ihrer Urheber von privaten Unternehmen getroffen werden muss, mit all den aus diesem multipolaren Privatrechtsverhältnis folgenden Problemen für einen effektiven Rechts- und vor allem Grundrechtsschutz nicht nur der Beteiligten selbst, sondern auch der Informationsempfänger. Auch wenn man das grundlegende Anliegen des Gesetzentwurfs für legitim erachtet – und wer könnte sich ernsthaft gegen die Verhinderung von Straftaten wenden? -, ist die vorgesehene Lösung untauglich, jedenfalls aber erheblicher Kritik von juristischer Seite ausgesetzt. Es wäre daher ein grober rechtlicher, jedenfalls aber rechtspolitischer Fehler, das Gesetz in seiner derzeitigen Form zu verabschieden.
Wenn der Gesetzgeber mit Blick auf entsprechende Straftaten in sozialen Netzen tatsächlich Handlungsbedarf sehen sollte, wären stattdessen alternative Lösungsmodelle weiterzuverfolgen und vor allem sorgfältig auszuarbeiten. Möglichkeiten hierfür gibt es reichlich: von der besseren Ausstattung von Ordnungsbehörden und Staatsanwaltschaften, die entsprechende Beschwerden zum Anlass nehmen können, nach einer den grundrechtlichen Vorgaben angemessenen Prüfung die Verantwortung für entsprechende und ihrerseits gerichtlich überprüfbare Sperrungsanordnungen gegenüber den Diensteanbietern zu übernehmen, bis hin zu innovativen Instrumenten wie Klagerechten für „Medienschutzverbände“, die dann wie Verbraucherschutzverbände privatrechtlich gegen Rechtsverstöße vorgehen könnten, aber entsprechende Prozessrisiken tragen würden, so dass sie zu einem sorgfältigen, auf echte Rechtsverstöße beschränkten Vorgehen angehalten würden. Die neuen Wege, die der vorliegende Gesetzentwurf beschreitet, führen dagegen auf eine schräge Bahn hin zu einer grundrechtsfeindlichen Diskussionskultur bzw. -infrastruktur. Das ist nicht die Straße, die ein demokratischer Gesetzgeber beschreiten sollte. Dass die Unionsfraktion am Vorabend der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfs nun erhebliche Nachbesserungen angekündigt hat, ist ein erster Schritt in die richtige (Gegen-) Richtung. Mehr aber noch nicht.
[22.5.2017: Die Beiträge von Prof. Dr. Marc Liesching und Prof. Dr. Thomas Hoeren wurden nachgetragen.]
Andreas Blohm
Neueste Artikel von Andreas Blohm (alle ansehen)
- Offener Brief an die Bundesregierung für ein AfD-Verbot - 26. Januar 2025
- Mastodon-Städtereisetipps Stuttgart - 28. August 2023
- Kita-Warnstreiks – Schreiben an die kommunalen Arbeitgeber - 7. März 2022